Les Misérables - Die Elenden
Victor Hugo
DIE ELENDEN
Les Misérables
Roman
Aus dem Französischen von Edmund Th. Kauer
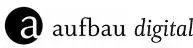
Impressum
Titel der Originalausgabe
Les Misérables
ISBN 978-3-84120551-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Bei Aufbau Taschenbuch erstmals 2000 erschienen © der deutschen Übersetzung Atrium Verlag AG, Zürich (nach der gekürzten und überarbeiteten Fassung von E. Th. Kauer, erschienen 1933 im Peter J. Oestergaard Verlag, Berlin) Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Covermotiv © Universal Pictures Germany GmbH
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Erster Teil
Fantine
Erstes Buch Ein Gerechter
Zweites Buch Der Fall
Drittes Buch Im Jahre
Viertes Buch Anvertraut – ausgeliefert
Fünftes Buch Der Abgrund
Sechstes Buch Javert
Siebentes Buch Der Fall Champmathieu
Achtes Buch Der Gegenstoß
Zweiter Teil
Cosette
Erstes Buch Der Kreuzer »Orion«
Zweites Buch Einlösung eines Versprechens, das der Toten gegeben wurde
Drittes Buch Das Haus Gorbeau
Viertes Buch Jagd im Dunkeln, stumme Meute
Fünftes Buch Die Friedhöfe nehmen, was man ihnen gibt
Dritter Teil
Marius
Erstes Buch Der Großbürger
Zweites Buch Großpapa und Enkel
Drittes Buch Die Freunde des ABC
Viertes Buch Lehrmeister Unglück
Fünftes Buch Begegnung zweier Sterne
Sechstes Buch Der schlechte Arme
Vierter Teil
Eine Idylle in der Rue Plumet und eine Epopöe in der Rue Saint-Denis
Erstes Buch Eponine
Zweites Buch Das Haus in der Rue Plumet
Drittes Buch dessen Anfang nicht dem Ende gleicht
Viertes Buch Der kleine Gavroche
Fünftes Buch Freude und Leid
Sechstes Buch Wohin?
Siebentes Buch Der 5. Juni
Achtes Buch Ein Atom verbrüdert sich mit dem Orkan
Neuntes Buch Corinthe
Zehntes Buch Die Großtaten der Verzweiflung
Elftes Buch Die Rue de l’Homme Armé
Fünfter Teil
Jean Valjean
Erstes Buch Eine Schlacht zwischen vier Wänden
Zweites Buch Im Reich des Kotes
Drittes Buch Enkel und Großvater
Viertes Buch Die Nacht des 16. Februar
Fünftes Buch Dämmerung
Sechstes Buch Dunkelheit und letztes Licht
Vorwort
Solange es kraft Gesetz und Sitte eine soziale Verdammnis gibt, die inmitten unserer Zivilisation künstlich Höllen schafft und der göttlichen Vorsehung ein menschliches Fatum hinzufügt, solange die drei Probleme des Jahrhunderts, die Entwürdigung des Mannes durch das Proletarierdasein, die Schändung des Weibes durch den Hunger, die Verwahrlosung des Kindes durch die geistige Finsternis, in der es gehalten wird, solange diese drei Probleme nicht gelöst sind, solange in gewissen Lebensbezirken der soziale Erstickungstod möglich ist oder, von einem noch allgemeineren Gesichtspunkt aus betrachtet, solange auf Erden Unwissenheit und Elend herrschen, dürften Bücher wie dieses hier nicht überflüssig sein.
Victor Hugo, 1862
Erster Teil
Fantine
Erstes Buch
Ein Gerechter
Myriel
Im Jahre 1815 war Charles-François-Bienvenu Myriel Bischof von Digne. Er zählte damals etwa fünfundsiebzig Jahre und hatte sein Amt seit 1806 inne.
Obwohl dieser Umstand nicht eigentlich zu unserer Erzählung gehört, ist es vielleicht nicht überflüssig, und wäre es auch nur um der Genauigkeit willen, hier gewisse Bemerkungen und Gerüchte zu erwähnen, die im Umlauf waren, als er in seiner Diözese eintraf. Was von Menschen gesagt wird, gilt ja in ihrem Leben, mag es wahr oder falsch sein, ebensoviel wie ihre Handlungen. Nun, Myriel war der Sohn eines Rates beim Parlamentsgericht zu Aix, entstammte also dem Beamtenadel. Man erzählte, sein Vater habe ihm sein Amt vererben wollen und habe ihn darum schon mit achtzehn oder zwanzig Jahren verheiratet, wie dies wohl bei den Beamtenfamilien der Brauch ist. Trotz dieser Heirat hatte Charles Myriel, wie behauptet wurde, viel von sich reden gemacht. Er war von gefälligem Äußern, wenn auch von kleiner Statur, elegant, geschmeidig, geistvoll; der erste Teil seines Lebens war zur Gänze weltlichen Dingen und galanten Abenteuern gewidmet.
Da brach die Revolution aus, die Ereignisse überstürzten sich, die Beamtenfamilien wurden blutig verfolgt, verjagt, außer Landes getrieben. Charles Myriel wanderte schon zu Beginn der Revolution nach Italien aus. Seine Frau erlag dort einem Lungenleiden, an dem sie schon seit Jahren krankte. Kinder hatten sie nicht.
Was ging damals in Myriel vor? War es der Zusammenbruch der alten französischen Gesellschaft, der Sturz seiner eigenen Familie, waren es die tragischen Ereignisse des Jahres 93, die den Ausgewanderten in der Fremde noch schrecklicher und ungeheuerlicher erscheinen mußten, war es dies, was ihn der Welt entfremdete und zur Einsamkeit trieb? Oder hatte ihn inmitten seiner Zerstreuungen und Vergnügungen, die sein Leben ausfüllten, plötzlich einer jener geheimnisvollen Schicksalsschläge getroffen, die zuweilen selbst den Mann ins Herz treffen, den allgemeine Katastrophen nicht zu erschüttern vermochten – wenn sie auch sein Glück und seine Existenz vernichteten? Niemand hätte diese Frage zu beantworten gewußt; bekannt war nur, daß er, aus Italien zurückkehrend, Priester war.
1804 war er Pfarrer von Brignolles. Er war bereits alt und führte ein sehr zurückgezogenes Leben.
Zur Zeit der Kaiserkrönung führte ihn ein unbedeutendes Amtsgeschäft seiner Pfarrei – es ist darüber nichts Näheres bekannt – nach Paris. Unter anderen einflußreichen Persönlichkeiten mußte er auch den Kardinal Fesch aufsuchen. Eines Tages also, als der Kaiser seinen Onkel besuchte, wartete der würdige Pfarrherr zufällig gerade im Vorzimmer, und so traf es sich, daß er unvermittelt Seiner Majestät gegenüberstand. Napoléon sah, daß der Alte ihn mit einer gewissen Neugierde anstarrte, wandte sich um und fragte brüsk:
»Wer ist der gute Mann, der mich so ansieht?«
»Sire«, erwiderte Myriel, »Sie sehen einen guten Mann und ich einen großen. So kommen wir beide auf unsere Rechnung.«
Am selben Abend fragte der Kaiser den Kardinal nach dem Namen dieses Pfarrers, und einige Zeit später war Myriel nicht wenig verwundert, zu hören, daß er zum Bischof von Digne ernannt worden sei.
Was an allen diesen Geschichten strenge Wahrheit war, konnte niemand angeben, denn nur wenige Familien hatten vor der Revolution mit den Myriels in Verbindung gestanden.
So mußte Myriel das Schicksal aller teilen, die in einer Kleinstadt neu angekommen sind, wo viel gesprochen und wenig gedacht wird. Er mußte es über sich ergehen lassen, obwohl er Bischof war, ja gerade weil er Bischof war. Aber schließlich war alles Gerede, das sich mit ihm beschäftigte, eben nur auf vage Vermutungen gestützt – Geschwätz, leere Worte; Palaver, wie man in der energischen Sprache des Südens sagt.
Wie dem auch sei, nach neun Jahren, die er in Digne zugebracht hatte, war all das Geschwätz, das in kleinen Städten zuerst die kleinen Leute beschäftigt, verstummt, und niemand wagte es mehr aufzurühren.
Myriel war in Begleitung eines alten Fräuleins, Mademoiselle Baptistine, seiner Schwester, die zehn Jahre jünger war als er, nach Digne gekommen. Seine ganze Dienerschaft bestand aus einer Magd, desselben Alters wie Fräulein Baptistine, Frau Magloire, die seinerzeit Wirtschafterin des Pfarrers Myriel gewesen war und jetzt das Doppelamt der Kammerfrau Fräulein Baptistines und der Haushälterin von Monsignore versah.
Mademoiselle Baptistine war eine hochgewachsene, blasse, hagere, sanfte Person; sie war die Verkörperung alles dessen, was man ehrbar nennen möchte; denn um auf Ehrfurcht Anspruch zu haben, muß eine Frau Mutter sein. Hübsch war sie nie gewesen; aber ihr Leben, das nur aus einer langen Reihe wohltätiger Werke bestand, hatte ihr schließlich eine gewisse Reinheit und Klarheit des Wesens verliehen, die man die Schönheit der Güte nennen möchte. Wenn sie in ihrer Jugend mager gewesen war, so konnte man jetzt, in ihrem reiferen Alter, fast von Durchsichtigkeit sprechen.
1 comment