Er baute seiner
erstaunlichen Produktivität gerade das Heim am Roseneck
– ein Mensch, an dem Zeit und Weile vorüberglitten, als
sei er ihnen nichts schuldig, immer voll der Muße einer wie
unbewußt selbsttätigen, unangetriebenen Seele, mit
gleichzeitig arbeitenden Händen, waltend bei Telephongeschrei,
Kindergeläut und dem Getrappel seiner kommenden oder
scheidenden Besucher – Träger des geheimnisvollen
Glücks, ohne Qual und Problem vollkommen in seiner Art zu
sein. Bei ihm, an einem Sonntagnachmittag, wurde ich mit Paul
Cassirer bekannt.
Ich hatte mich mit dem Esel und seinen kindlichen Tyrannen im
Hof getummelt und ging hinein, um mich zu verabschieden. Gaul,
Tuaillon und Cassirer standen qualmend im Dampf eines jener
berühmten Gespräche, die auch damals schon der eine von
ihnen begann, entspann, leitete, fortführte, belebte,
erweiterte, verwickelte und auch beendete, wenn ein Ende
unvermeidlich war. Cassirer kam mit mir ins nächste Zimmer und
forderte mich auf, ihm Arbeiten zu senden. Da ich indes keine
vorrätig hatte, so unterblieb auch ihre Absendung, und es
verging ein halbes Jahr, wo mich denn Cassirer zu einem Besuch
aufforderte und mir ein Abkommen vorlegte, nach dem ich meine
zukünftigen Arbeiten ihm übergeben sollte. Ich schlug
zwar ein, und es war reichlich Grund vorhanden, um diese neue
Gelegenheit zum Aufatmen in meinem Gemüt willkommen zu
heißen, aber es blieb zwischen uns einstweilen bei einem sehr
gewissenhaften Beobachten unseres Vertrages.
1909 bezog ich ein Atelier in der Villa Romana in Florenz, wohin
ich eine vorbereitete Arbeit überführte, begann und
beendete, und wo ich in unerschütterlicher
Selbstgerechtigkeit, erst mit der Axt, dann mit dem Meißel in Holz
weitere Stücke vorbereitete, begann und beendete.
Eines schönen Tages lag die majestätische,
vielpfündige Inkarnation des Däublerschen Sterngeistes
hinter den schmierigen Marmortischen des Café Reininghaus, lag
da wie ein ausladendes Inkognito eines exotischen Machthabers breit
im halbdunkeln Hinterhalt, im Versteck vor Hetze und Qual des
Daseins, ein Alleswisser und Nichtsbesitzer, in seiner Höhle
voll trauriger Behaglichkeit des Lebens ohne Lebensnotdurft froh.
Das zwölfjährige Werden, das Ausstoßen des
»Nordlichts« war vollbracht, aber die Zukunft des
»Nordlichts« war dunkel, und Zweifel über das Kommen
seines dreibändigen Leibes schüttelten Däubler und
nährten seine chronische Panik.
Moeller van den Brück saß im selben Sommer an
denselben Marmortischen, hielt die Fäden der Verhandlung und
zeigte in Däublers und eigenen Dingen den noblen Stolz eines
Vertrauens, das sein Recht in der Absolutheit einer schaltenden
Notwendigkeit erkennt. Noch im gleichen Sommer begann der Druck des
Werkes, und es geschah mit wunderbarer Grandezza, daß
Däubler dem korrekturlesenden Moeller-Bruck Verskatarakte und
Sternstürze aus Weltkernen als unerläßliche
Ergänzungen des Ganzen in die Hände schob.
Öfter zogen wir zusammen durchs toskanische Land und
»arbeiteten«, wie Däubler das nannte, uns durch die
Städte und ihre Offenbarungen. Wohl erkannte ich die
Schönheit der italienischen steinernen Strenge, ihre edle
Verstaubtheit, die silberne Schwermut der in Türmen
kristallisierten Marmorbrüche, die Greifbarkeit des
städtischen Behagens in der Fügung von Platz und
Straße, das musikalische Formspiel des Raumes – aber an
einem düsteren Dezembermorgen desselben Jahres stand ich
seltsam ernüchtert wieder auf dem Potsdamer Platz. Es
fröstelte mich vor der Unliebsamkeit von Ort und Stunde, aber
ich spürte in ihrem Anhauch eine Aufforderung und
Verheißung. Solche scheinbaren Abschreckungen mögen
bärbeißig heißen und bewirken doch eine heilsame
Hinlenkung auf das unverlierbare Eigene – ein frostiger
Dezembermorgen kann ein Spiegel sein: wie man sich erkennt, so sei
es hingenommen, und so muß es durchlebt werden.
Cassirer saß mir an einem Tage des folgenden Jahres in
seinem Zimmer gegenüber und befragte mich um den Grund meines
zurückhaltenden Betragens. Ich offenbarte ihm den
Gemütszustand eines besseren Wilden gegenüber seiner
vielfach verknoteten und geschichteten Wesenheit. Darauf
öffnete er den Mund und forderte mit natürlich heiterer
Feierlichkeit mein Vertrauen, in einer geraden Unverhohlenheit,
gegen die ein Widerspruch der letzten Instanz aus der Tiefe in mir
nicht erfolgte.
Und wir wurden ein seltsames Freundespaar – nichts von
»Paulchen und Gaulchen« wie zwischen ihm und Gaul,
keinerlei restlos bequemes Hausen unterm Freundschaftsdach, und
doch immer wieder freie Rückkehr zu unbedenklicher
Offenheit.
Ich bin gewiß, daß ein Dorn an meinem Wesen in
Cassirers Gemüt allzeit geeitert hat, aber der Spieler
Cassirer hatte doch wohl ein wenig Bedarf nach der Verstocktheit in
Abseitigkeit, Menschenflucht und Ruhe im Herrn der Herrlichkeit,
der da preislich und pomadig waltet und seiner Kinder keines
verkümmern läßt. Der Spieler Cassirer, der
Händler, der Herr über ein Heer von Parolegläubigen,
der Sturmbock im Gewühl und Austrag der Meinungen, der
erfolgreichste Perlenfischer und schlaueste Einfädler und
Anstifter bei der Heimführung von Überschüssen, der
Preisgeber und Bewahrer seines Selbst in großem Format, war
zugleich der böse Bruder des Künstlers Cassirer und des
so leicht zu beglückenden, sich selbst selig preisenden
großen Kindes Cassirer, der den bösen Bubenstreichen so
arg zugetan war und dionysisch durch die Welt zu brausen begehrte.
Sein eigener böser, auftrumpfender und beinstellender Bruder
zu sein war Paul Cassirers tragisches Geschick.
Er baute und er redete in Zungen, zu schreiben, behauptete er,
vermöge er nicht. Er sprudelte und schwamm am liebsten im
Strom seiner siedenden Rede, und es würde eines dicken Bandes
bedürfen, um seine Berliner Spaße, seine
Kriegsgeschichten, seine Händlerromane, seine erlebten
Kostbarkeiten im Verkehr mit Wedekind, Liebermann, Corinth und
– ein Dutzend der besten Namen müßte folgen –
vor dem Vergessenwerden zu behüten.
Zweierlei muß ich noch unterstreichen, einmal, daß er
darunter litt, Nutznießer von Künstlern genannt zu
werden, denen, die ihm so verwandt waren, mit denen er, wie der
Hamburger sagt, aus einer Büttel trank, und weiter, daß
er verwegen war wie selten einer. Seine Tapferkeit dürstete
nach der Nähe der Gefahr, da, wo er die bestmögliche
Unmittelbarkeit der Entscheidung witterte, wo kein Schild deckte,
keine Anonymität schäbig schützte, nicht wo im
bombensichern Unterstand das grobe und klare Abmachen verschlissen
werden konnte, fühlte er sich wohl. Gewiß hat er sein
Recht nach eigenem Befund zugerichtet, aber zum Kneifen war er
nicht geschaffen, und mit unmäßiger Risikofreudigkeit
stellte er sich in den Brennpunkt der Entscheidungen.
Er trieb meine Lämmer auf die Weide, meine erbärmlich
frierenden plastischen Erstlinge, und, da er einmal die Hände
rührte, so klinkte er zugleich ein Pförtchen für
etwas anderes von mir auf. Als er mich aufforderte, ein
lithographisches Werk für die Panpresse beizusteuern,
erwähnte ich ein »Drama«, das man vielleicht als
Gerüst zur Aufreihung von Motiven benutzen könne. Er
zuckte weder mit der Wimper, noch zögerte er einen Augenblick
mit der Antwort: »Na ja, also zeichnen Sie.«
Ich lithographierte, und die Mappe wurde eine regelrecht
viereckige, normale und einstweilen unverkäufliche Mappe,
einschließlich eines Textbandes zum »Toten Tag«.
Dieser Band sah aus, als wäre er gefunden und der Finder
hätte ihm in der geräumigen Mappe einen vorläufigen
Unterschlupf angewiesen. Cassirer, sonder Mitschuld an dem Drama,
das er nicht gelesen, begann ein generöses Herumschenken in
Stadt und Land, und der Textband, warm geworden im Nest, gab sich
drein.
Der lange Schicksalsweg meiner Mutter schien nun abgelaufen. Im
Jahre 1900 war sie zu meinem Bruder nach Texas auf die Hungerfarm
gegangen, sie hatte sich müdegekämpft und suchte bei
Joseph in Seattle vergeblich, was sie nie finden sollte, die leise
glimmende Freude im Teilhaben eines am Leben des andern bei
gemeinsamer Not und bescheiden bemessenem Glück. Kein noch so
erbärmliches bißchen Heil ließ sich zu ihnen herab
– wenn die Zucht ihrer Jahre unterschiedlich geriet, so war
sie es gewiß nur im verschiedenen Grade der Dürre, von
fetten hat sie nichts zu spüren bekommen; wenn es einen
Wechsel gab, so wechselten die schlimmen mit noch schlimmeren.
Schicksal teilte mit vollen Händen aus, aber mit keiner
Gutes.
Zurückgekehrt, erkrankte sie und lebte lange wie sterbend,
zog endlich nach Güstrow und empfing von mir in ihre
kraftlosen Hände meinen Sohn zur Erziehung. Sie hatte Kraft zu
wollen und bekam die Kraft, es zu vollenden.

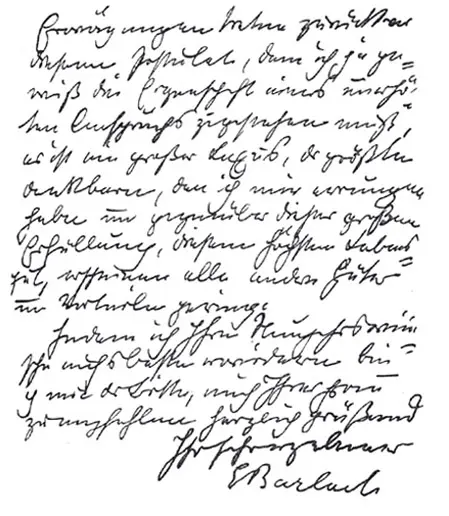
Verkleinertes Faksimile des letzten von zehn
Briefen Ernst Barlachs an den Leipziger Historiker und
Universitätsprofessor Dr. Karl Weimann aus den Jahren
1919-1925
Original im Besitz der Barlach-Gesellschaft, Hamburg.
Der Brief hat folgenden Wortlaut:
Güstrow i M
Schwerinerstr. 22
12. 1. 25
Sehr geehrter Herr Professor,
ich danke Ihnen bestens für Ihre freundlichen Wünsche,
die mich ganz richtig in Güstrow im alten Räume
erreichten. Versicherungen wie die Ihrigen, daß meine
Produktion empfängliche Herzen findet, gehören zu dem
Wertvollsten, was man erfahren kann, stellen ja die eigentliche
Belohnung alles Strebens dar. Mein Dank für Ihre Bekundung ist
also tief wie das ihn erzeugende Erlebnis.
Ich werde wohl Güstrow nicht verlassen, jeder Besuch
außerhalb überzeugt mich wieder von der
Unmöglichkeit, anderswo die Freiheit, ich meine die einfache
persönliche Ungeschorenheit zu finden, die bei mir zur Arbeit
unerläßlich ist. Alle anderen Erwägungen treten
zurück vor diesem Postulat, dem ich ja gewiß die
Eigenschaft eines unerhörten Anspruchs zugestehen muß, es
ist ein großer Luxus, der größte denkbare, den ich
mir errungen habe un[d] gegenüber dieser großen
Erfüllung, diesem höchsten Lebensgut, erscheinen alle
ändern Güter und Vorteile gering.
Indem ich Ihre Neujahrswünsche aufs Beste erwidere bin ich
mit der Bitte, mich Ihrer Frau zu empfehlen herzlich
grüßend
Ihr sehr ergebener
E Barlach
.
1 comment